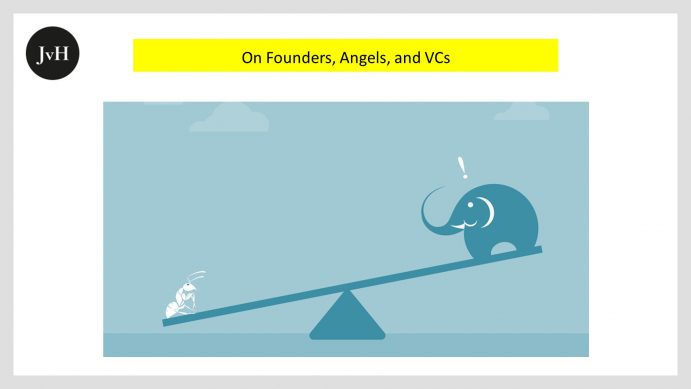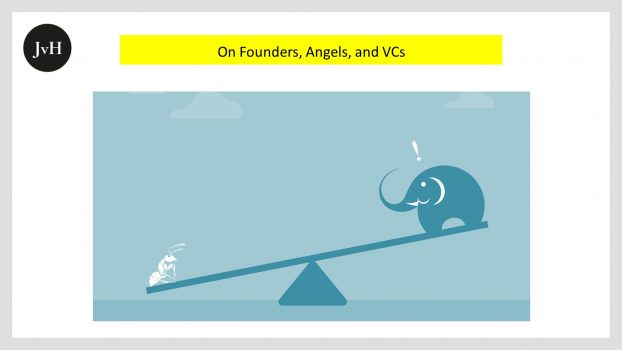
Ein interessanter, in der Praxis herausfordernder und fachöffentlich unterbelichteter Gegenstand innerhalb der globalen Startup-, VC- und Business Angel-Blase ist das schwierige Dreieck, das bei fast allen aussichtsreichen Gründungen zwischen Startups, VCs und Angels aufgespannt wird. Grob verallgemeinert und vereinfacht kann die wechselseitige Wahrnehmung der jeweils anderen Stakeholdergruppen wie folgt auf den Punkt gebracht werden:
1. Die Sicht der Gründerinnen und Gründer
„Ohne VCs geht es halt nicht“
VCs betrachten Startup-Gründer als anspruchsvolle, überwiegend professionelle, bisweilen sehr anstrengende Geldgeber, die für das gegebene Eigenkapital vertraglich sanktioniert überproportional viel Einfluss auf ihre Beteiligung nehmen wollen (und können), allerdings, anders als vor vielen Jahren, wenigstens längst nicht mehr darauf aus sind, ihnen dabei die Schuhe auszuziehen. VCs, das hat sich herum gesprochen, wissen, dass die Gründermotivation für den Startup-Erfolg key ist. Nicht umsonst achten sie bei ihren Due Diligences sehr darauf, dass Gründerinnen und Gründer in den Seed- und Series A-Runden über mehr als nur kosmetische Anteile an `ihren´ Unternehmen halten.
„Angels sie sind sooo anstrengend“
Angels dagegen sind in ihren Augen Akteure, die ihnen zwar ein bisschen Geld geben und für dieses bisschen Geld auch keinen überproportional großen Einfluss ausüben können, allerdings oft lästig sind, weil sie, anders als als VCs, als Privatiers nicht Profis sind. Daher gilt es, sie über Syndikate mit einer Poolsprecherin bzw. einem Poolsprecher so einzuhegen, dass zeitraubende und lästige Angel-Interventionen durch kluges Time Management bei Reporting Calls etc. auf ein Minimum reduziert werden. Und für die den Gründern „geraubte“ Zeit sollen im Gegenzug echte Angel-Mehrwerte springen: Leadbeschaffung, Investorenkontakte, Marktinfos usf..
2. Die VCs – Perspektive
„Gründerinnen und Gründer: Failures sind ein einzupreisendes Risiko“
Für VCs sind Gründerinnen und Gründer Chance und Risiko im Hinblick auf die ihren LPs und ihrem Carry zu liefernde Perfomance. Die allermeisten VCs sind bereit, bei jedem einzelnen Investment große Risiken einzugehen, soweit mit einem großen Risiko auch eine große Chance einhergeht. Was zählt, ist die Portfolio-Performanz. Die ist auch möglich, wenn 90% der Investments Nieten sind, bei den übrigen 10% dafür aber Einhörner winken. Idiosynkratische oder auch nur „schwierige“ Gründerinnen und Gründer werden solange toleriert, wie sie performen, denn VCs wissen, dass Performanz und Idiosynkrasie durchaus zusammengehen können. Echte Outlier sind vielleicht sogar idiosynkratisch bedingt. Bleibt die Performance aus, dann allerdings lässt man sie schnell fallen, denn Zeit ist Geld – auch für GPs. Sie rechnen damit, dass ihnen, coûte que coûte, gründerseitig Performanz vorgeführt wird und sie wissen, dass diese Show notfalls durch kreative Gestaltung der Fakten zustande kommt: “Fake it, till you make it”. Anders als Angels betrügen sich VCs dabei selten selbst; eine schlechte Wahl beim Dealflow ist in die Zielperformance des Portfolios eingepreist. Wenn das Ding nicht läuft, dann tschüss.
„Business Angels sind ein notwendiges Übel“
Angels sind für VCs ein notwendiges Übel. Im Kern teilen VCs die vorstehend wiedergegebene Position der Gründerinnen und Gründer. Über Liquidationspräferenzen und Wasserfälle werden Angels wirtschaftlich marginalisiert. Und via CapTable-Anforderungen, Gesellschaftsverträge, Satzungen und Beiräte neutralisiert man das Risiko eines gemessen an den kumulierten Stimmenanteilen der Angels anderenfalls übergroßen un- oder nur semiprofessionellen Angel-`Headcounts´ in den Gesellschafterversammlungen. Es gibt VCs, die das anders sehen. Das sind dann oft solche, die Angels als LPs an Bord haben. Oder es sind öffentliche.
Öffentliche VCs respektieren und suchen den privaten „Angel – Mut“
Öffentliche VCs und VCs mit Public Private Partnership – Gesellschafterstruktur sind gegenüber Angels meist gnädiger gestimmt, denn dort erfüllt man auch einen öffentlichen Auftrag und weiß, dass echtes privates Kapital von direkt investierenden Individuen und deren Vehikeln ein Must sind, wenn das eigene Startup-Ökosystem blühen soll. Das Gros des privaten Frühphasen-Kapitals stammt nicht von VCs oder Corporates oder Family Offices, sondern von Business Angels. Kleinvieh macht viel Mist.
Angels VC-seitig zu hofieren ist smart. Daher lassen die meisten öffentlichen oder halböffentlichen VCs ihre Investments von Angels in einem vorab definierten Verhältnis „spiegeln“. Und nicht wenige VCs machen es ihnen inzwischen nach: Lästigkeit hin oder her: Angels bringen, zumal wenn sie eigene Gründererfahrung auf den Tisch legen, wertvolles Netzwerk, wertvolle Coaching-Ressourcen und wertvolles Branchenwissen mit.
3. Die Angel-Brille
Gründerinnen und Gründer: Die Metamorphose von Buddies zum `Schurken´
Zu Beginn ihres Investments hegen Angels gegenüber Gründerinnen und Gründern meist freundschaftliche, beinahe mütterliche oder väterliche Gefühle. Das gilt auch für Angels, die selbst noch jung oder sehr jung sind aber bereits einen oder mehrere erfolgreiche Exit-Erfolge hinter sich haben. Das ist zwar gefährlich, weil eine zu persönliche Beziehung dazu führen kann, dass Angels freundschaftlich über den Tische gezogen werden und beispielsweise bei Folgerunden oder Bridgerunden weiter ein Startup stützen, an dessen Erfolg sie nicht mehr glauben oder glauben sollten. Unter dieser sympathisch menschlichen, kaum überwindbaren „Unprofessionalität“ der meisten Angels gegenüber ihren Beteiligungen, die oft an Selbstbetrug grenzt, leiden VCs nicht, da die es sich nicht leisten können, Portfolios in den Sand zu setzen. Insoweit sind Angels oft nützliche Idioten. Und das merken sie meist erst, wenn es zu spät ist.
In den späteren Phasen kommt es zwischen Angels und Gründerinnen und Gründern allerdings fast unauswichlich zu Antagonismen. Angels bekommen mit sinkendem Unternehmensanteil und zunehmendem Management-, Markt- und Praxiswissen der Gründer ein immer schwächeres Standing im Zirkus. Das führt dazu, dass das Verhältnis zwischen beiden fortschreitend weniger freundschaftlich, weniger einvernehmlich und weniger vertrauensvoll wird. Es entschwindet beides: Der eben noch substanzielle Stimmenanteil der Angels und ihr zu Beginn der Beziehung oft noch vorhandener Wissens- und Erfahrungsvorsprung. Unerfahrene Angels suchen den fortschreitenden Machtverlust durch bilaterale Gespräche und, wenn das nicht hilft, was es meist nicht tut, durch „Lautstärke“ zu kompensieren, was alle übrigen Stakeholder nervt und den CapTable belastet. Aus Angel-Sicht gilt: Der Faktor Mensch in der Angel-Gründer-Beziehung birgt sicherlich für beide Seiten Chancen. Doch es überwiegen die Risiken.
VCs: Die Metamorphose vom tollen Investor zum gierigen Gegner
Gegenüber VCs sieht die Einstellung und Position der Angels ähnlich aus. Zunächst freuen sich Angels, wenn ein – idealerweise renommierter – VC entweder gemeinsam mit ihnen oder jedenfalls in der Folgerunde investiert. Mit fortschreitendem Startup-Alter und den einhergehenden Finanzierungsrunden sinkt der im letzten Abschnitt schon beschriebene Einfluss der Angels, während derjenige der investierten VCs zunimmt. Nicht selten müssen Angels nach einer Folgerunde den Beirat zugunsten eines VCs verlassen und selbst wenn das nicht der Fall ist, bleibt VCs und Angels nur noch ein Interesse gemein: Einen guten Exit zu erreichen. Über das Wie? muss es kein Einvernehmen mehr geben. Angels, die ihren Einfluss nicht auf Know-how oder exitrelevante Kontakte stützen können, haben schlicht nichts mehr zu melden. Tatsächlich alliieren sich diese beiden Stakeholdergruppen, VCs und Gründer, gefühlt einfach deswegen, weil der VC und die Gründer die Calls machen, während Angels nur in den eben beschriebenen Ausnahmefällen spezieller und exklusiver Exit-Kontakte eine Rolle spielen können. Das schmerzt, zumal dann, wenn Angels meinen, es besser zu wissen oder zu können. Besonders schmerzhaft wird es, wenn VCs ihre Beteiligung aufgegeben haben, weil andere, lukrativere ihre Aufmerksamkeit verlangen. Aber das wussten sie, die Angels, von Anfang an oder hätten es wissen können. Natürlich werden dann auch gerne (Vor)-Urteile mobilisiert: VCs verwalten ja nur das Geld anderer Leute. Sie gehen kein persönliches Risiko ein… .
4. So what?
Was ist nun an dieser dynamischen Interessenslage im beschriebenen Kräftedreieck interessant und relevant? Es sind drei Punkte:
4.1 VCs investieren in wenige Startups viel, Angels investieren in viele Startups wenig
Volkswirtschaftlich relevant ist, dass Angels, obwohl sie nicht nur in Deutschland monetär signifikant viel stärker an Frühphasen-Startups beteiligt sind als VCs, gemessen an dem Einfluss der VCs einen verschwindend geringen Anteil an der Gestaltung, den Erfolgen und Misserfolgen ihrer Beteiligungen haben. Ja, sie bringen Netzwerke, Erfahrung und Kontakte mit. Doch sie entscheiden nicht. Dies gilt auf der Ebene einer jeden einzelnen Beteiligung ebenso wie auf der Ebene der aggregierten Angel- und VC-Beteiligungen. Was immer in der Öffentlichkeit zum Thema Startup-Finanzierung herrschende Meinung geworden ist, stammt von VCs, nicht von Angels. Beispiel: „Neun von zehn Startups scheitern“. Stimmt so zwar überhaupt nicht, wird aber von jedermann als Faktum geglaubt, weil kein Unterschied gemacht wird zwischen den überwiegend und durchaus erwartungsgemäß meist nicht von Ferne eintreffenden sehr hohen Renditeanforderungen die VCs an ihre Einzelbeteiligungen richten und einem tatsächlichem Scheitern (Insolvenz oder Liquidation). Dies ist zunächst nicht einem Versagen der Angel-Lobbyisten geschuldet. Es liegt, überspitzt gesagt, daran, dass der riesige Ameisenhaufen der Angels mühelos von wenigen Bullen zertrampelt werden kann. VCs investieren in wenige Startups viel, Angels investieren in viele Startups wenig. Ändern ließe sich das Ungleichgewicht des Einflusses erst, wenn diese Ameisen giftig wären und/oder fliegen könnten und/oder sich zu Angel Clouds verbinden könnten. Nichts davon ist der Fall oder perspektivisch umsetzbar.
4.2 Warum sollten Angels mehr Einfluss haben?
Betriebswirtschaftlich relevant für jedes einzelne Startup ist die Frage, welcher Schaden gegebenenfalls daraus erwächst, dass der Angel-Einfluss mit zunehmendem Unternehmensalter zunehmend marginal wirkt. Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen zu sagen: „Ist doch gut so. VCs sind Profis und werden von Profis gemanagt. Angels sind Hobby-Investoren mit einer zwar monetär nützlichen aber deswegen nicht zwingend fachlich gebrauchten Clout.“ Nach diesem Prinzip handelt die Bundesregierung: Sie incentiviert über das laufend verschlimmbesserte INVEST-Förderprogramm First-time Angels und lässt diejenigen, die viel investieren und wirklich Erfahrung haben, im Regen stehen, weil sie ja sowieso investieren.
Dieses Argument ist schlecht. Gerade in Sachen Dealflow sind Angels alles in allem die weitaus besseren Trüffelsucher als VCs. Nicht von ungefähr engagieren gute VCs gute Angels als Venture Partner, um die besten Deals an Land zu ziehen. Angels sollten und könnten VC-seitig orchestriert werden, indem man die spezifischen Fähigkeiten und Kontakte der Angels optimal einsetzt und sie dort brillieren lässt, wo sie besser als VCs sind. Das wird, jedenfalls in Deutschland, kaum betrieben. VCs lassen z.B. sehr oft Hochschulabgänger als Analysten an die Front, um die erste Filterstufe des Gründer-Recruitings zu machen und zu managen, obwohl gerade auf dieser ersten Filterstufe das Know-how von erfahrenen Managern und ehemaligen Gründern gefragt wäre. Die können belastbar (er) beurteilen, ob eine Gründerin oder ein Gründer das Zeug hat, das jeweilige Startup entscheidend voran zu bringen.
Eine VC-seitig gute gemanagte Angel-Orchestrierung ist also ein Desiderat mindestens für das hiesige Ökosystem. So könnte verhindert werden, dass bereitstehendes und kostenlos abrufbares Angel-Know-how brach liegt oder gar destruktiv wirkt. Sämtliche Stakeholder würden profitieren.
4.3 VCs interessiert die Fondsrendite, Angels die Rendite jeder Einzelbeteiligung
Der letzte und für mich interessanteste Aspekt des beschriebenen Angel-Gründer-VC-Dreiecks betrifft die immer wieder komplett übersehenen fundamental anders gelagerten und tatsächlich sogar konfligierenden Investitionsabsichten von Angels und VCs. Auch wenn es in der Theorie meist besser gewusst wird: Im Kopf der meisten Akteuere auf dem Spielfeld werden Angels trotzdem schlicht als kleine VCs wahrgenommen. Ein grober Irrtum. Der wirklich relevante Unterschied zwischen beiden Gruppen liegt nicht in der Größe der Investitionssumme, die einem Startup von VC- und Angel-Seite zuteil wird, sondern in dem jeweiligen Renditeziel. Klar, beide wollen den wirtschaftlichen Erfolg möglichst jeder Beteiligung. Doch jeder Angel und jeder VC weiß: Nieten sind unvermeidlich. VCs, privaten jedenfalls, geht es immer und ausschließlich um den Portfolioerfolg. Angels dagegen geht es immer um den Erfolg jedes einzelnen ihrer Investments. Die mediane derzeitige Portfoliogröße deutscher Angels, 4!, ist deutlich zu klein, um als typischer deutscher Angel, wie ein VC, auch nur daran denken zu können, viele Nieten in Kauf zu nehmen, um den einen Outlier einzufangen, der die Verluste der Nieten hinreichend attraktiv überkompensieren könnte.
Die Founder DDs guter Angels und guter VCs haben jeweils andere Zielprofile im Blick
Daraus folgt, dass Angels, denen von VC-Seite Zielunternehmen als Opportunität angeboten werden, extrem vorsichtig sein sollten, weil das Risiko, dass sie sich in Nieten einkaufen, extrem groß ist. Und umgekehrt sollten VCs, denen Angels als Venture Partner ein Investment empfehlen, ebenso vorsichtig sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das betreffende Startup der VC-gesuchte Outlier ist, genauso gering ist. Angels suchen in aller Regel solide, halbwegs „sichere“ Investments: Wenig Risiko und ein attraktiver aber gefühlt realistisch möglicher Return. Den allermeisten VCs kann das nicht genügen. Wenn Angels also gemeinsam mit VCs investieren wollen und VCs ihnen die Mühen der DD abnehmen, dann sollten sie wissen: Die Legal Due Diligence, die Market Due Diligence, die Financial Due Diligence mögen in den Händen eines VCs gut aufgehoben sein. Die Founder Due Diligence und, mutatis mutandis, die Product Due Diligence dagegen auf keinen Fall. Und umgekehrt gilt das ebenso.
Was sonst? Angels sind gut beraten in Startups zu investieren, deren Produkte und Märkte sie so gut kennen, dass sie ihren Startups tatsächlich den nachgefragten Mehrwert jenseits des Kapitals liefern können. Es ist gut, wenn Startups gezielt Angels suchen, die ihnen dabei behilflich sein können, Markteintrittsbarrieren aus dem Weg zu räumen. Dieser Nutzen muss aber eben auch seinen Preis haben dürfen. Dieser Preis wird nicht durch einen 15% Discount bei Wandlung eines Wandeldarlehns oder durch 8% Zinsen abgegolten, denn dadurch wird nur das größere eingegangene Risiko des frühen Investments und der Verzicht auf alternative Investments bis zur Wandlung honoriert. Sobald sich das Startup in seinem Markt allein zurechtfindet, ist dieser gesuchte Angel-Nutzen konsumiert. Wenn der Angel ihn vorher nicht über Unternehnmensanteile monetarisieren konnte, wird er Frust erleben. Und der belastet dann alle Stakeholder.