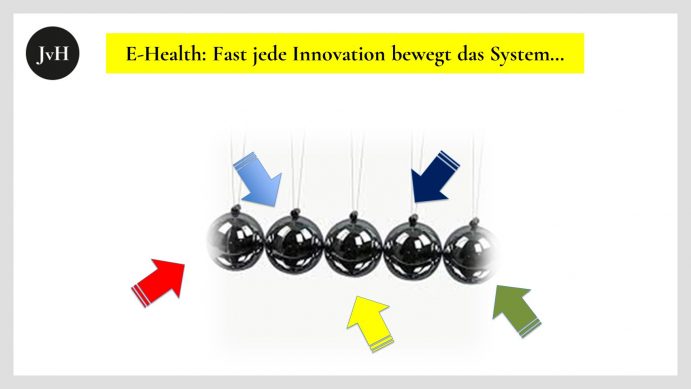Bisweilen ärgere ich mich. Ich ärgere mich über Experten, die mit einer Autorität, die ihnen aufgrund einer akademischen und/ oder Verbandsfunktion hierzulande von Haus aus zuwächst, „Expertisen“ verbreiten, deren empirische Sachhaltigkeit mangels falsifizierbarer Aussagen nicht angreifbar ist, obwohl die gemachten Aussagen auf tönernen Füßen stehen. Die gemachten „Befunde“ bleiben dann bestehen, denn unbeschadet ihrer fehlenden Falsifizierbarkeit muss es ihnen ja nicht an rhetorischer Wucht mangeln. Im Gedächtnis der Fachöffentlichkeiten bleiben sie kleben, selbst wenn sie mit der „wirklichen“ Wirklichkeit kaum etwas zu tun haben. Solange das im Wege privater Blogs mit überschaubarer Reichweite geschieht, muss einen das nicht kümmern. Wenn sich solche Expertisen jedoch des Megaphons überregionaler Printmedien bedienen dürfen, z.B. solcher, hinter denen angeblich „immer ein kluger Kopf“ steckt, dann wird es bedenklich und ich ärgere mich nicht nur, sondern wundere mich auch.
Dieser Tage las ich also in der FAZ unter der Überschrift: „Ohne Geschäftsmodelle fliegt Digital Health nicht“ eine Bestandsanalyse des digitalen Gesundheitsmarktes – verfasst von Prof. Volker Amelung und Dr. Particia Ex, ihres Zeichens Vorstandsvorsitzender bzw. Geschäftsführerin des Bundesverbandes Managed Care (BMC). Frau Ex hat an der TU Berlin Gesundheitsmanagement studiert und in dieser Fachrichtung auch promoviert; sie übt ihren Job mutmaßlich hauptberuflich aus. Herr Prof. Amelung ist außerdem Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover und Geschäftsführer der Berliner inav, privates Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, einem „im Gesundheitswesen tätige[n] Forschungs- und Beratungsinstitut mit den Schwerpunkten Versorgungsforschung, innovative Versorgungskonzepte, Digital Health, Market Access und Reimbursement.“
DVG: Digitale Prozess-Innovation für den deutschen Gesundheitsmarkt
Der FAZ-Beitrag erfolgte zu einer Zeit, als die digitalen Zeichen im deutschen Gesundheitsmarkt wieder einmal auf Aufbruch standen: Gesundheitsminister Jens Spahn, einer der wenigen Bundesminister, vor denen ich wirklich meinen Hut ziehe, da er nicht nur redet, sondern auch „macht” und außerdem, wie mir aus nächster Nähe kolportiert wurde, fähig zu sein scheint zuzuhören, Jens Spahn also hatte soeben im Deutschen Bundestag das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) durchgebracht. Mehr oder minder zeitgleich hatte eine erfolgreiche Berliner Gründerin namens Diana Heinrichs gerade gemeinsam mit vielen anderen Gründerinnen und Gründern aus Deutschland öffentlichkeitswirksam ein „Manifest für die Digitalisierung im Gesundheitswesen“ veröffentlich, das u.a. fordert, „Datenschutz“ solle nicht als Markteintrittsbarriere für Start-ups instrumentiert werden, denen es darum geht, pseudonymisierte Patientendaten zu aggregieren, zu strukturieren und anschließend zu Therapie- und Forschungszwecken der Pflege-, Gesundheits- und Pharmaindustrie anzubieten.
Ein booking.com für den Gesundheitsmarkt zu fordern ist abwegig
Auf diesen Resonanzboden traf nun also der Befund von Prof. Amelung und Patricia Ex.
Ihre zentrale Aussage lautet: „Während wir uns seit elf Jahren an den Grundlagen der elektronischen Patientenakte und der Interoperabilität abarbeiten, bleiben die eigentlichen Game Changer aus. In einem internationalen Vergleich der Bertelsmann Stiftung zu dem Thema belegt Deutschland den vorletzten Platz […].“ Daran schließt sich die rhetorische Frage an: „Ist einer der zentralen Gründe für diesen Stillstand, dass kaum Geschäftsmodelle für die Beteiligten entstehen können?“ Die Antwort der beiden: „Aus digitalen Ansätzen wird ein Geschäftsmodell, wenn zentrale Akteure einen Mehrwert erhalten, den sie ansonsten nicht haben. Innovationen haben in der Regel leider nicht für alle einen Vorteil. […] Digital Health – Anwendungen sind entwickelt, in Studien belegt, ihre Sicherheit geprüft, auch werden Wege für ihre Erstattung definiert. Aber damit sie in der Breite der Gesundheitsversorgung ankommen, bedarf es tragfähiger Geschäftsmodelle.“ (Zu) viele Start-ups in diesem Digitalmarkt befassten sich mit „Insellösungen und Pilotprojekten“ aus denen nicht hinreichend viele „wesentliche Beteiligte“ des Gesundheitsmarktes einen hinreichend signifikanten Vorteil zögen. Zu einem (guten) Geschäftsmodell gehöre: 1. Dass aus ihm hinreichend viele Stakeholder (mein Wording) einen hinreichend großen Nutzen ziehen, 2. dass sie aus „bestehenden Systematiken“ ausbrächen.
Als jemand, der seit vielen Jahren mit – toitoitoi – erfreulichem Erfolg in frühphasige Start-ups investiert, auch und besonders in solche, die im digitalen Gesundheitsmarkt tätig sind, fragte ich mich, worüber die beiden Autoren hier schreiben, was sie meinen und ob sie möglicherweise die Worte, die sie benutzen, gar nicht verstehen. Doch dann recherchierte ich die Berufsbiographien der beiden und musste diese Frage negativ beantworten.
Natürlich ist es für den Erfolg eines Unternehmens, gleichgültig ob Start-up oder nicht, egal ob im Gesundheitsmarkt oder in der Süßwarenindustrie, wesentlich, über ein gutes Geschäftsmodell zu verfügen. Das wissen selbst die schlechtesten Gründer. Deswegen ändern die besseren von ihnen in der Frühphase ihrer Gründungen laufend ihr Geschäftsmodell und justieren es anhand der testweise von ihnen ausgelösten Marktreaktionen. Niemand in Deutschland würde ein Health-Start-up in die Landschaft setzen, das nicht über ein Geschäftsmodell verfügt. Zu meinen, e-Health-Gründer in Deutschland hätten es überwiegend nur auf technische Innovationen abgesehen ist abwegig. Wie gut die jeweiligen Geschäftsmodelle sind, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die pauschale Behauptung aber, „Digital-Health-Ansätze in Deutschland“ blieben „bisher meist Insellösungen und Pilotprojekte“ lässt sich eben nicht ohne Weiteres falsifizieren, weil „Insellösung“, „Pilotprojekt“ und „meist“ wachsweiche Begriffe sind. Darüber hinaus aber, und das ist wesentlich, darf mit Fug bezweifelt werden, dass ausgerechnet im Gesundheitswesen ein innovativer Impuls lediglich bei einer einzelnen Stakeholdergruppe als isolierte Insellösung verbleiben kann. Denn die Systemlogik spricht dagegen. Was Patienten nützt, nützt auch den Kassen. Was Patienten nützt, nützt auch den Ärzten, Gesundheitsdienstleistern usf…
Bei der Lektüre des FAZ-Gastartikels stellt sich unwillkürlich auch die Frage, in welche Richtung die Kritik eigentlich zielt: Aus der Kritik an den Geschäftsmodellen der meisten e-Health-Akteure muss der Leser ableiten, nach Auffassung der Autoren hätte das Gros der Gründer und der sie unterstützenden Investoren noch nicht recht verstanden, welches Lied gespielt wird. Andererseits erklären die Autoren, „Geschäftsmodelle für die Beteiligten“ könnten gar nicht entstehen. Es sei „Aufgabe der Gesundheitspolitik sowie der Selbstverwaltung, neue Wege zu entwickeln um, die [.] Innovationen zum Patienten“ zu bringen. Der Thrust bleibt diffus: Amelung und Ex sagen, „wir“ arbeiteten uns an der elektronischen Gesundheitsakte ab, anstatt uns Gedanken um funktionierende Geschäftsmodelle zu machen. Worauf gründet diese Behauptung? Wer ist der Angeklagte? An welcher Stelle soll was geschehen, damit mehr „tragfähige Geschäftsmodelle“ in den Markt eintreten können? Was ist überhaupt ein „tragfähiges Geschäftsmodell“ im deutschen Gesundheitsmarkt – jenseits der richtigen Auflage, dass es mehr als nur einer einzigen Zielgruppe einen Nutzen bringen sollte.
Auch Widersprüche treten in dem Beitrag zutage: Einerseits werden technischen Insellösungen, Innovationen und Pilotprojekte ohne hinterlegte Geschäftsmodelle kritisiert, andererseits wird erklärt, Innovationen stellten „plötzlich die Logik des Systems auf den Kopf“. Sorry, von welcher „Logik“ und von welchem „System“ ist hier die Rede? Ist das „System“ verantwortlich dafür, dass die Gründerinnovationen ein Geschäftsmodell bekommen?
E-Health: Warum „Insellösungen“ trotzdem für gute Geschäftsmodelle taugen
Das System der deutschen Gesundheitssystem ist ebenso komplex wie schwerfällig. Weder eine Produktinnovation noch eine, sagen wir, gesetzgeberische Prozessinnovation, wird es „auf den Kopf stellen“ wollen oder können. Jede „insuläre“ Innovation innerhalb des Systems, ob „Ganganalyse zur Sturzprävention“, „Analyse von Wechselwirkungen verordneter Medikamente“, „automatische telemedizinische Überwachung von Vitalparametern“, „intelligente Dokumentationen“ operiert innerhalb des Systems und mit ihm und hat dabei allerdings durchaus die Potenz, zum „Game Changer“ eines Subsystems, einer Nische innerhalb dieses Systems zu werden. Der Mehrwert für nahezu alle Stakeholder des jeweiligen Subsystems ist dabei in aller Regel so offensichtlich, dass es dazu keines kreativ ersonnenen komplexen Geschäftsmodells bedarf. Dieses liegt, im Gegenteil, in der Regel offen auf dem Tisch. Denn von einer solchen Innovation können, wie es die Autoren zutreffend fordern, eben nicht nur isolierte einzelne Stakeholder profitieren. Es profitieren über signifikante Kosteneinsparungen die Versichertengemeinschaft, über solide therapeutische Nutzen die Patienten, über neue relevante Datenpools die forschende Arzneimittelindustrie und über Zeitgewinne die behandelnden Leistungsträger und damit wiederum mittelbar alle Beteiligten.
Ein Booking.com oder YouTube für den Gesundheitsmarkt zu fordern, bedeutet schlicht Märkte zu verwechseln. In Gesundheitsmarkt ist aufgrund der regulatorischen Systembedingungen ein B2C-Plattform-Geschäftsmodell à la eBay oder booking.com nicht vorstellbar.
Warum „Insellösungen“ trotzdem für gute Geschäftsmodelle taugen
Betrachten wir, nur mal so als Beispiel, das noch ganz frische Digitale-Versorgung- Gesetz (DVG). Das erlaubt es nun Patienten z.B. kostenpflichtige Gesundheits-Apps auf Rezept in einem App-Store oder sonst wo herunterzuladen, insoweit diese Apps unter die Medizinprodukte-Klassen I oder II a fallen. Bei Apps ist das die Regel. (Denn Apps sind nun einmal nicht-invasiv; sie werden also von Patienten oder deren Angehörigen nicht durch künstliche Körperöffnungen etwa in der Bauchdecke betrachtet. Und Apps sind nicht dazu da, autonom, also von sich aus, therapeutische Maßnahmen zu initiieren.) Werden solche Apps „das System auf den Kopf stellen“? Wohl kaum. Können solche Apps Bestandteil eines funktionierenden Geschäftsmodells sein? Warum nicht? Denn Apps helfen Patienten dabei, sich compliant zu verhalten und nützen so mittelbar oder unmittelbar allen: Den beitragszahlenden Bürgern und Unternehmen, den Ärzten, Kliniken und sonstigen Trägern medizinischer und protomedizinischer Leistungen, den Kosten sparenden Kassen und vor allem: den gesünder lebenden Patienten. Wie gut das Geschäftsmodell ist, wird davon abhängen, wie vielen Patienten ein echter Nutzen zur Verfügung gestellt wird und was das jetzt angedachte „Forschungsdatenzentrum“ mit den über die Apps gewonnenen pseudonymisierten Patientendaten gegebenenfalls wird anstellen können.
Viele erfolgreiche deutsche Start-ups im Bestandsmarkt Primärprävention
Beim DVG geht es allerdings, andererseits, explizit nur um therapeutische Versorgungsmaßnahmen. Die Primärprävention, also Gesundheitsvorsorge, bleibt außen vor. Und was bedeutet „außen vor“? Dass sie von Kassen erstattet werden darf aber nicht muss. Und das ist schon lange so. Auf dem Gebiet der Primärprävention findet das DVG also gar nicht statt. Geschäftsmodelle, denen es im Vorfeld manifester Erkrankungen z.B. um die Convenience von Patienten und/ oder Pflegekräften im Wege von Apps oder anderen „Medizingeräten“ geht, ferner um die komfortable Datenerfassung im Wege solcher Apps und schließlich um die pseudonymisierte Datenaggregation und -strukturierung im Wege nachgelagerter Backend-Strukturen, solche Geschäftsmodelle wurden vom deutschen Gesetzgeber bei der Formulierung des DVG aus gutem Grund weitgehend außen vor gelassen, solange sie den Patienten nicht schaden. Es obliegt dann der Verhandlung der Kassen mit den Anbietern, ob und wie der Krankheiten vorbeugende „Mehrwert“ solcher „Geräte“ in Gestalt eingesparter Therapiekosten honoriert wird. Aber es profitieren ohne Frage sowohl die Patienten als auch die Kostenträger und die Leistungsträger.
Was dann mit den gewonnenen Daten passiert, ist eine Angelegenheit, die zwischen dem betreffenden Start-up und Dritten, die als nicht-Patienten Zugriff auf den Datenschatz bekommen sollen, bilateral verhandelt wird. Hier winkt eine zusätzliches und gegebenenfalls sogar das wesentliche monetäre Vergnügen. Das geplante „Forschungsdatenzentrum“ dagegen, von dem man Konkretes bis heute noch nicht weiß, bewegt sich auf dem Fundament einer ganz anderen Definitionsmenge, der der Therapie. Bei der Vorsorge haben wir also schon lange Verhältnisse, die es Start-ups erlauben, mit patientenfreundlicher Technologie und forschungsfreundlichen Datenstrukturen, höchst innovativ zu sein und gute Geschäfte zu machen.
Fazit: Innerhalb des schwerfälligen deutschen Gesundheitssystems kann man im therapeutischen Kontext als e-Health-Startup fabelhaft innovativ sein. Bietet man einer einzelnen Stakeholdergruppe einen signifikanten Benefit, haben im Regelfall alle System-Beteiligten quasi automatisch etwas davon. Insoweit man sich im Vorsorge-Kontext bewegt, kann man als Start-up darüber hinaus schon lange, befreit von vielen regulatorischen Beschränkungen, Patientennutzen generieren. Auch hier profitieren über den generierten Patientennutzen mittelbar alle Stakeholder des Systems.
Warum erklären Frau Ex und Herr Amelung, es gebe bisher „meist“ und „nur“ Insellösungen, es bedürfe „tragfähiger Geschäftsmodelle“?
Zwei spekulative Antworten liegen nahe:
Entweder die Autoren kennen sich zwar in ihren Märkten aus, übersehen dabei aber, dass erfolgreiche Start-ups noch nie irgendwo auf der Welt jemals die Norm dargestellt haben, sondern, im Gegenteil, stets die Ausnahme sind. Zu erklären, es bedürfe auf dem digitalen Gesundheitsmarkt mehr „tragfähiger Geschäftsmodelle“ wäre insoweit nicht falsch aber trivial. Mehr ist natürlich immer besser. Aber hervorragende Start-ups gibt es eben nirgends wie Sand am Meer. Oder aber die Autoren meinen, für sich einen Markt entdeckt zu haben, den sie beratend begleiten möchten. Daran ist nichts auszusetzen. Doch sollten dann vielleicht die Analyse ein wenig profunder, die Kritik ein wenig spezifischer und die Lösungsangebote ein wenig innovativer sein.