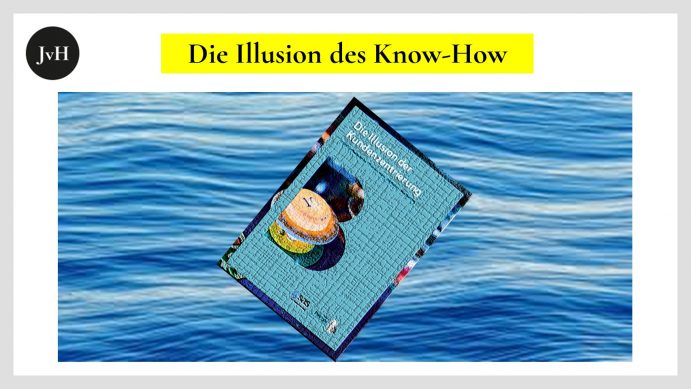Letzte Woche habe ich mich in einem Post einigermaßen unfreundlich über ein sogenanntes Whitepaper von @RolandBerger und @sas-dach geäußert. Es trägt den stolzen Titel „Die Illusion der Kundenzentrierung, 5 unbequeme Thesen zum digitalen Marketing“.
Schimpfen ist immer leicht. Daher möchte ich an dieser Stelle die Gründe für meine Kritik nachholen.
Mit ihr sollte nicht gesagt sein, die deutsche Wirtschaft benötige keine Transformationsberatung. Natürlich benötigt sie diese. Es sollte ebenso wenig gesagt sein, alle Berater oder Beratungshäuser, die sich hier engagieren, seien durch die Bank weg schlecht. Es gibt tatsächlich viele, die eine exzellente Arbeit machen.
Diese machen sie allerdings regelmäßig nur dann, wenn sie die Ziele ihrer Kunden ernst nehmen und daraus abgeleitet die effektivsten und effizientesten heute verfügbaren Mittel, Instrumente, Methoden und Strategien zur Verfügung stellen. Sie machen ihre Arbeit ganz sicher falsch, wenn sie ihren Klienten in dem vermeintlichen Wissen um die Zukunft der digitalen Wirtschaft erzählen, welche Ziele diese haben sollten.
Schlechte Berater, die ihren Kunden erzählen, wie die Zukunft aussehen wird, auf die sie diese vorbereiten wollen, sind in aller Regel zugleich Berater, die sich entweder nicht die Mühe machen zu analysieren, wo die Kunden herkommen oder die zu dieser Analyse nicht fähig sind. Denn dazu bräuchte man Erfahrung mit tradierten Methoden und Strategien, die insbesondere junge Hochschulabgänger, so qualifiziert sie in ihren Spezialdisziplinen auch immer sein mögen, schlicht nicht haben können.
Wer erstens nur weiß oder zu wissen glaubt, wo die Reise hingehen soll und wer zweitens die Ozeane, aus denen die „Tanker“ angerollt kommen, nicht selbst erfahren hat, der kann bei der Transformation keine große Hilfe sein. Noch einmal: Wirklich kein Mensch kann wissen, wo die Reise der digitalen Transformation tatsächlich hingehen wird. Darüber lässt sich nur trefflich spekulieren. Wenn man weder die Vergangenheit, noch die Zukunft kennt, geschweige denn versteht, sondern nur den Instrumentenkoffer des Hier und Heute in der Hand trägt, dann kann Beratung zu keinem guten Ende führen.
Es ist daher gut und klug, dass sich einige der namhafteren Häuser, zu nennen wären beispielsweise pwc und ey, junge Startup-affine Beratungsbeiboote zugelegt haben (ey – etventure) oder aber mit solchen projektweise kooperieren. Hier können beide Seiten, diejenigen, die die „alte Welt“ und diejenigen, die die neue kennen, voneinander lernen, um Klienten dann auf dem Boden eines umfassenden Methoden- und Erfahrungsschatzes kundenbedarfsgerechte Lösungen anbieten zu können.
Die erste „unbequeme“ These des eingangs zitierten Whitepapers lautet: „Der Kunde bestimmt die Marke und seinen Umgang mit dem Unternehmen. Es ist die Ära der Konzentration auf den Kunden. Das umfasst das gesamte Unternehmen. Aber viele Unternehmen sind auf die Kundensouveränität nicht eingestellt. Kunden denken allein an ihre Bedürfnisse, sie interessieren sich nicht dafür, welche Werbe- und Vertriebskanäle die Unternehmen für erforderlich halten […]“
Was, bitte, ist an dieser „These“ „unbequem“. Was an ihr ist „neu“, also überhaupt thesentauglich, statt nur trivial zu sein? Seit wann hat sich ein Kunde in seiner Eigenschaft als archetypischer Markenkunde überhaupt jemals dafür interessiert, wie ihm eine Markenbotschaft dargebracht wird, also via TV, Radio, Plakat, als Werbebotschaft, subkutane PR-Botschaft in einem Exklusivbericht oder in Gestalt einer wirksamen Kombination all dieser und anderer Kanäle? Was unterscheiden in dieser Hinsicht diese traditionellen Kanäle von den inzwischen ebenfalls schon „klassisch“ zu nennenden unterschiedlichen Bannertypen oder sponsored Posts und „kuratierten“ Inhalten?
Richtig: Nichts. Zu behaupten, Kundenkommunikation sei früher nicht kundenzentriert gewesen, ist schlicht geschichtsvergessen. Der Kunde ist schon lange „König“.
Haarsträubend ist auch die flankierende Erläuterung: Markenkommunikation sei früher „formal, inhaltlich und zeitlich integriert“ gewesen. Marken hätten „über Produkte und Qualität“ gesprochen, „Kampagnen im Mittelpunkt“ gestanden. „Heute“ – dagegen (sic) – sei „der Kunde Kern und zentraler Bezugspunkt der integrierten Kommunikation“. Marken „kreierten gemeinsame Visionen und Beziehungen“. Kundeninteraktion führe zum Erfolg.
Richtig ist, dass die Eigenschaften der Markenprodukte einander immer ähnlicher werden, weil die Transparenz der Produkteigenschaften und der Herstellungswege exponentiell zugenommen hat. Warum? Weil die informatorische Asymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern nicht mehr existiert und die Marktmacht der über das Netz alliierten potenziellen und bestehenden Kunden zuungunsten der Hersteller gekippt ist.
Dies wiederum deshalb, weil sich die Menschen inzwischen nicht nur im Handumdrehen online austauschen können, sondern weil sie außerdem mühelos und schnell zu Wettbewerbern abwandern können, insbesondere dort (aber nicht nur dort), wo die Distributionswege digital sind. Mutatis mutandis werden daher die Produktversprechen und Leistungen der Wettbewerber rund um den Globus immer ähnlicher; sie wandeln sich einander an und verlieren ihre jeweilige Alleinstellung.
Deshalb (und nur deshalb) legen sich Marken kulturelle, soziale und weiterhin auch partikulare, ihnen möglichst ausschließlich eigentümliche Serviceattribute zu. Wie sonst will man heute noch als Normalverbraucher zwischen Nike, Puma und adidas, zwischen Telekom und vodafone oder zwischen BMW, AUDI und Mercedes sinnvoll unterscheiden können?
Diese kulturelle Aneignung kann nicht im Wege einer Einbahnstraße erfolgen. Kultur lässt sich nicht konzipieren und planen, sie muss durch Interaktion mit den Adressaten „entstehen“. Das ist ohne Frage richtig. Die Interaktion der Kunden untereinander sowie die beidseitige Kommunikation der Kunden mit den Markenartiklern ist also in der Tat zentral, wenn kulturelle Zielgruppennähe authentisch wirken soll. Allerdings wird diese Authentizität über sämtliche Kommunikationskanäle wie eh und je „strategisch“ geplant und „integriert“. Und auch das Ziel der Marken, möglichst als Unikate in ihren Märkten dazustehen, als authentische Qualitätsangebote wahrgenommen zu werden, ist gleichgeblieben.
Fazit: Der Kunde ist smarter geworden und also muss auch die Kundenkommunikation der Marken mindestens so smart bleiben, wie sie es schon immer war. Heute bedeutet dies eben, erfolgreich darum bemüht sein zu müssen, als integraler Bestandteil der Kundenkulturen wahrgenommen zu werden. Marken spielen heute mit Influencern das gleiche Spiel, dass sie früher mit Testimonials gespielt haben.
Aber daraus, dass Botschaften heute in den sozialen Medien nicht mehr platziert, sondern stattdessen die Inhalte der Influencer „kuratiert“ werden, wie der Euphemismus lautet, kann man nicht ernsthaft ableiten, Markenanbieter hätten kein Interesse daran, zu beeinflussen und diese Einflussnahme strategisch zu planen und durchzuführen. Wer das unterstellt ist nicht von dieser Welt. Im Übrigen ist diese Strategie des subtilen „kulturellen Imperialismus“ durch Marken keine Geburt der digitalen Welt.
Die Strategie ist sehr viel älter. Im sogenannten Social Marketing der gesundheitlichen Primärprävention beispielsweise wusste man schon lange, dass man Zielgruppen nicht allein dadurch zu Verhaltensänderungen bewegt, dass man ihnen Wissen darreicht. Die uralte und nach wie vor zutreffende Doktrin hört auf das Akronym KAP – Knowledge, Attitude, Practice. Zu Deutsch: Nachdem man das Wissen der Kunden aktualisiert hat, geht es darum, die Einstellungen der Kunden zu modifizieren. Erst danach kann man sich daran machen, das Kaufverhalten zu beeinflussen.
Mit den weiteren „unbequemen“ Thesen von Roland Berger und des Analytics Software Anbieters sas ist es nicht besser bestellt. Die Aussagen sind platteste Verkaufsberatung und dabei entweder, wie gezeigt, empirisch falsch oder komplett inhaltsleer oder widersprüchlich oder schlecht begründet und immer wieder wirklich schlecht formuliert. Da hilft auch kein englischer, sich bedeutsam gerierender Jargon.
Inhaltsleer: „Für erfolgreiche Omni-Kanal-Strategien ist die intelligente Verknüpfung von Daten unerlässlich. Die Kunden sollten entlang ihrer Customer Journey erfasst und verstanden werden.“ Aha! Oder: „Unternehmen müssen abwägen, wie nahtlose Markenerlebnisse sinnvoll geschaffen werden können. Aber Unternehmen dürfen dabei nicht die ökonomische Vernunft aus den Augen verlieren und sollten nur das anbieten, was auch sinnvoll ist.“ Wow! Hatte doch der Kunde bisher insgeheim gehofft, er könne Markenerlebnisse über nahtumsäumte „Erlebnisse“ unsinnig, ineffizient, uneffektiv und kostspielig ins Werk setzen.
Widersprüchlich: „Damit geht die Zeit der Bauchentscheidungen zu Ende.“ vs: „Intuition spielt weiterhin eine wichtige Rolle, muss aber auf einer soliden Datenbasis beruhen.“
Ja was denn nun: Geht die Zeit der Bauchentscheidungen zu Ende oder nicht?
Schlecht begründet: Der voranstehende Widerspruch ist offensichtlich. Hinzu kommt aber, dass es ziemlich egal ist, ob eine willkürliche Bauentscheidung auf soliden Daten beruht oder auf gar keinen oder auf falschen. Solange die Entscheidung selbst nicht rational ist, sollte es gleichgültig sein, ob sie auf stabilem oder wackligem Boden steht. Wenn das Haus aus schlechtem Baumaterial (Argumenten) besteht, dürfte es keine Rolle spielen, ob es von alleine in sich zusammenfällt oder deswegen, weil es auf Sand gebaut wurde.
Schlecht formuliert: „Die Big Data-Ära hat Kunden in ihrem eigenen raffinierten Fortschritt [bei der Kundensegmentierung] ertrinken lassen.“
Gemeint ist damit, dass die Unternehmensfortschritte bei der datengetriebenen Kundensegmentierung Unternehmen dahin gebracht haben, unter einem informatorischen Überfluss zu leiden, der es ihnen unmöglich mache, aus den generierten Erkenntnissen über ihre Kunden effiziente und effektive Kommunikationsstrategien abzuleiten.
Die Formulierung suggeriert, dass die „Big Data-Ära“, also der Lauf der Zeit, verantwortlich für das „Ertrinken“ sei. Die Schuld wird also nicht in der Fehlentscheidung der betreffenden Unternehmen gesehen, einen Überfluss an Daten generiert zu haben ohne zu wissen, wie man diesen Datenschatz erntet, sondern in der Macht des Daten-Schicksals. Doch wer nicht, nicht mehr oder noch nicht schwimmen kann, der- oder diejenige sollte nicht den Wellen die Schuld geben.