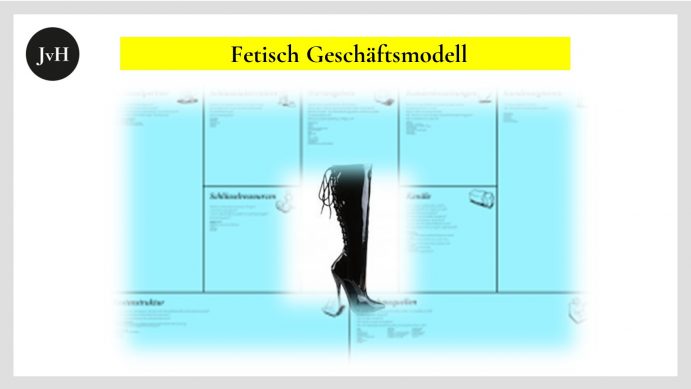In der Literatur und in den Diskussionen der Fachöffentlichkeiten zu Internetplattformen wird immer wieder zu recht auf die sehr häufig anzutreffende Verwechslung oder zumindest Vermischung zweier unterschiedlicher Merkmale digitalen Plattformen hingewiesen:
- Die ihr Geschäftsmodell auszeichnenden starken „Netzwerk-Wirkungen“ (network effects),
- das ihre Nutzer kennzeichnende große Interesse, die jeweils eigene Community zu motivieren, ebenfalls die Plattform zu gebrauchen („virality“).
Während Netzwerk-Effekte den intrinsischen Mehrwert einer großen Nutzerschar für Plattformen und ihre Nutzer markieren, geht es bei der Viralität um die Frage, wie schnell sich die „good News“ einer Plattform unter ihren Nutzern und vor allem unter ihren potenziellen Nutzern verteilt.
Netzwerk-Effekte
Je mehr Übernachtungsanbieter bei Airbnb gelistet sind, umso größer ist die Auswahl für Übernachtungs-Nachfrager. Je größer die Auswahl für Übernachtungsnachfrager auf Airbnb ist, desto größer wird die Attraktivität des Übernachtungsangebots auf dieser Plattform sein. Je größer die Attraktivität des Übernachtungsangebots bei Airbnb ist, desto größer wird die Zahl der Übernachtungsnachfrager sein, die sich bei Airbnb registrieren wollen. Je größer die Zahl der bei Airbnb registrierten Übernachtungs-Nachfrager sein wird, desto höher wird die Zahl der bei Airbnb Übernachtungsplätze anbietenden User sein. Ein großes, gutes Angebot schafft eine große Nachfrage und eine große, gute Nachfrage triggert wiederum ein großes Angebot. In der Regel.
Genau den gleichen Mechanismus findet man bei Uber, Lyft, eBay, Wikipedia, Facebook, linkedIn, XING und all´den anderen erfolgreichen Plattformen. Je nachdem, welchen Primärzweck sie für den User erfüllen sollen – besser und preiswerter einkaufen, besser und teurer verkaufen, sich besser und genauer informieren, sich besser mit Freunden, Bekannten oder Kollegen austauschen, effektiver und effizienter miteinander kollaborieren…: Eine große Nutzerzahl bietet die Chance auf eine größere Auswahl und/oder auf höhere Preis-, Kosten- und Informationsnutzen.
Der Begriff „Nutzerzahl“ ist dabei erklärungsbedürftig. Entscheidend für die Qualität der Plattform und ihre Netzwerk-Effekte ist nicht die ein- bzw. erstmalige Registrierung der User auf die dann gegebenenfalls keine oder nur wenig Aktivität folgt. Entscheidendes, also nachhaltig Erlöse generierendes Merkmal der Stärke und Güte von Plattformnetzwerken ist, dass die Nutzer rege und möglichst dauerhaft auf und mit ihnen interagieren.
Viralität
Bei der Viralität von Plattformen geht es dagegen darum, wie gut und schnell sich die Nachricht über die Vorteile einer Plattform gegenüber potenziellen Plattformnutzern verbreitet. Im Unterschied zu den Netzwerk-Effekten ist dies eine taktische Frage des Plattformmarketings, keine strategische nach den gewünschten Plattformeigenschaften.
Es ist vorstellbar und kommt auch immer wieder vor, dass sich die Nachricht über eine neue Plattform in Windeseile „viral“ verbreitet, obwohl diese Plattform möglicherweise im Vergleich zu einer bereits bestehenden oder auch künftigen Konkurrenz nur überschaubaren Nutzen bietet. Sie verspricht dann mehr als ihre Netzwerkwirkungen halten. In diesem Fall wirkt die Viralität ihrer Verbreitung wie ein Strohfeuer. Es fehlt an Plattformsubstanz, die sicherstellen kann, dass eine anhaltende Interaktion der User untereinander und der User mit der Plattform selbst stattfindet.
So erging es beispielsweise dem Job-Portal BranchOut, einer 2010 geborenen App, deren Ziel es war, ihren Nutzern Job-Informationen über ihre Facebook-Kontakte zu vermitteln, also ohne dass diese User auf klassische Job-Ausschreibungen in Print- und online-Medien zugreifen mussten.
Virales Wachstum führt, wenn die Netzwerk-Effekte fehlen, zu viralem Negativ-Wachstum
Die Zahl der auf BranchOut gelisteten User verbreitete sich über Facebook in einer Aufsehen erregend viralen Geschwindigkeit. Im Sommer 2012, nach drei Finanzierungsrunden und kumuliert nahezu 50 Mio. USD eingesammelten Kapitals, meldete BranchOut 33 Mio. User und stellte damit die Konkurrenz in den Schatten. Dann fiel die User-Zahl binnen weniger Monate von 33 Mio. auf eine sehr niedrige einstellige Millionenzahl zurück. Warum?
Vor allem aus einem Grund: Jenseits des Job – finden – Nutzens bot das Portal keinen weiteren netzwerkinduzierten Mehrwert. Hatte jemand über BranchOut einen neuen Job gefunden, blieb er oder sie anschließend nicht mehr aktiv. Wozu auch? Aus User-Sicht hatte die App ihren Zweck erfüllt. Die hohe Zahl der Erstregistrierungen infolge der viralen Facebook-Verbreitung führte nicht zu dem für jede Plattform entscheiden Erfolgskriterium, einer permanent hohen aktiven Nutzerzahl. Im Unterschied zu BranchOut bieten beispielsweise die Plattformen linkedIn und auch XING laufend über bloße Jobangebote hinaus reichende Nutzen an.
Schlüsselkriterium Größe
Eine Systematisierung der eingangs skizzierten Netzwerk-Effekte ist abhängig von dem hinter einer solchen Typisierung stehenden Zweck – einem Managementzweck, einem Investitionszweck, einem Marketing-, wirkungsmaximierenden oder sonst wie gearteten Zweck.
Von einer solchen Typisierung unabhängig bleibt der „kleinste gemeinsame Hauptnenner“ aller Netzwerkeffekte: Die ihnen zugrundeliegende „Größe“: Die Größe ihrer Nutzerzahl, der Intensitätsgrad der Plattformnutzung und die Dauerhaftigkeit derselben. Jeder beliebige Netzwerkeffekt lässt sich auf die Größe der Nutzerzahl, auf die Intensität der Nutzung und auf ihre Dauerhaftigkeit zurückführen.
Zwar ist es jeweils etwas anderes, ob eine Plattform eine große Auswahl an Angeboten infolge einer großen Anbieterzahl hat oder ob eine Plattform infolge der Nachfragebündelung von Nutzern einen günstigen Kaufpreis ermöglicht oder ob sie aufgrund einer großen Nutzerzahl ein breitgefächertes oder tief gestaffeltes Informationsangebot bereit hält. Und richtig ist auch, dass Größe allein solange nichts bringt, wie es den Plattformbetreibern nicht gelingt, diese Größe zieladäquat zu managen, also Angebote und Informationen zu filtern, zu redigieren und sonst wie nutzergerecht aufzubereiten.
Klar bleibt aber, dass jede beliebige Leistung in der auf einer Plattform bereit gestellten Leistungsdimension dann und nur dann strukturell, also aus Prinzip, gegenüber konkurrierenden Anbietern, ob dies nun ebenfalls Plattformen oder konventionell aufgebaute Unternehmen sind, überlegen ist, wenn der besagte Größenvorteil in Gestalt von Nutzungsintensität, Nutzungszahl und Nutzungsdauer gegeben ist.
Die Trennung von Asset-Besitz und Asset-Nutzen: Was digitale Plattformen so attraktiv für Investoren macht
Hat man erkannt, dass der Schlüsselmehrwert einer Internetplattform für die Plattform selbst wie auch für ihre Nutzer ihre Größe ist, dann wird schnell klar, warum sie für Investoren, also beispielsweise VC-Gesellschaften, so überaus attraktiv sind: Das Herstellen von Größe ist für konventionelle Unternehmen mit hohen Aufwänden verbunden. Hier ist es das nicht: Nicht der „Besitz an Produktionsmitteln” und auch nicht „Arbeit” generiert den Plattformnutzen. Denn die Assets, die die Werte schaffen, gehören überwiegend den Nutzern, also nicht den Plattformen und auch die Arbeit wird dezentral von ihnen, den Nutzern, geleistet.
BWL-Erstsemester kennen die immer wieder in der Literatur zitierten Beispiele für Infrastruktur-Monopolisten, die entweder als (ehemalige) Staatsunternehmen oder über Jahrzehnte währende, mühevolle, extrem kapitalintensive Aufbauarbeit zu Größe gelangt sind, zu genüge: Die Pennsylvania Railroad musste sich die Stahlfabrik Pennsylvania Steel kaufen, um genug Schienen verlegen zu können, die Canadian Pacific Railroad musste an die Provinzbörse New York Stock Exchange, um ihr Wachstum finanzieren zu können, AT&T, US Steel, Standard Oil u.v.m. waren staatlich hochpreisig anbietende Monopolisten, die deshalb, weil ihre Energie-, Telekommunikations- und Materialinfrastruktur, zumal in Kriegszeiten, dringend gebraucht wurde, als „natürliche Monopole” staatlich toleriert wurden.
Auch digitale Plattformen sind Infrastrukturen, gewissermaßen das „Straßennetz“ zwischen Nutzen-Anbietern und Nutzen-Nachfragern. Und dafür erhalten sie entweder von den Anbietern oder von den Nachfragern oder von beiden eine „Mautgebühr“.
Die Maut kann nutzungsabhängig (Mitgliedsgebühr) und/oder erfolgsabhängig (Transaktionsgebühr bzw. -provision) erhoben werden. Oder sie wird monetär überhaupt nicht gefordert und gezahlt, sondern erfolgt durch Rechtevergaben der Nutzer an die Betreiber, ihre Daten für mehr oder weniger beliebige, monetär verwertbare Zwecke zu nutzen.
Digitale Plattformen bieten damit, mehr als alles andere, sensationelle Skalenvorteile: Sehr überschaubare Kosten bei vorstellbar beinahe grenzenlosem Nutzen innerhalb der jeweiligen Nutzendimension.
Aber: Was, bitte, ist an digitalen Plattformen „revolutionär“?
In unserer Superlative liebenden Zeit werden Plattformen daher von vielen Marktteilnehmern und ihren Beobachtern gerne als „revolutionär“ tituliert. Ich bin der Auffassung, diese Bezeichnung ist vollkommen unangebracht.
In den Folgen 1 und 2 dieser kleinen Artikel-Serie hatte ich gezeigt, dass die wirtschaftliche Kernidee von Plattformen, gleichgültig ob analog oder digital, die Mengen-Bündelung einerseits und die käufergerechte Aufspreizung solcher Mengen andererseits, ein tradiertes Konzept ist, das nicht schon allein dadurch revolutionär wird, dass das Internet dieses Konzept im Hinblick auf die Zahl weltweit erreichbarer Nutzer und im Hinblick auf die mit ihm mögliche radikale Minimierung der Grenzkosten maximal ausreizt.
Jedes analoge Kaufhaus ist eine Plattform. Automobilbauer sind Plattformen, die von Tier 1 bis Tier n Zulieferer und von Leasingbanken, Taxiunternehmen, Finanzierern, staatlichen Verwaltungen über Firmen bis zu Privatkäufern heterogene Kundengruppen auf unterschiedlichen Umlaufbahnen an sich binden. Diese konventionellen Plattformen unterscheiden sich von den digitalen zugegebenermaßen in einem entscheidenden Punkt. Sie selbst sind der Leistungsanbieter. Das ist bei amazon nur manchmal, und zunehmend immer weniger der Fall. Und die ‘Artikel’ bei Wikipedia oder eBay stammen ausschließlich von den Nutzern.
Doch auch für amazon gibt es ein analoges Vorbild: Die Einkaufspassage, das EKZ! Dort werden den Endverbrauchern einerseits von den Ladenmietern, andererseits von dem Betreiber selbst Leistungen angeboten. Und beide, die Endverbraucher wie auch die Ladeninhaber, zirkulieren im Orbit um den zentralen Infocounter und die Hotline des EKZ-Betreibers herum, wie es der User und der App-Anbieter auf Facebook auch tun. Und schließlich tauschen im Schallplattenladen im Obergeschoss der Ladenpassage dieser Schallplattenladen und der Musikliebhaber Bares gegen Rares, wie dies auch auf digitalen Plattformen mit digital gespeicherter Musik zwischen Endverbrauchern oder zwischen Endverbrauchern und Plattformbetreibern möglich ist.
Wo also liegt der Unterschied zwischen einer beliebigen Ladenpassage oder einem EKZ auf der grünen Wiese und dem Einkaufsparadies amazon? Es gibt nur zwei: Die Größe und der große bzw. kleine Aufwand, der betrieben werden muss, um ein analoges Geschäft dort und ein digitales hier anzudocken.
Revolution – Evolution: Nur Wortklauberei?
Wen interessiert es, ob digitale Plattformen ein „revolutionäres Geschäftsmodell“ sind oder nicht? Nach meiner festen Auffassung verbirgt sich hinter der Frage ‚Revolution oder Evolution?‘ mehr als nur ein nutzloser Kampf um Worte. Denn im Umfeld der Plattformen, in der Venture Capital und Startup-Szene, bei Corporate Ventures und Unternehmensberatern, wird gerne so getan als seien digitale Plattformen das Wundermittel oder Patentrezept für jedwedes beliebige konventionelle Nicht-Plattform-Unternehmen. Nicht nur wird vieofach argumentiert, jedes beliebige konventionelle Pipeline-Unternehmen könne und solle versuchen, zu einem Plattformunternehmen zu mutieren; es wird auch gesagt, die hinter den Plattformen stehenden Geschäftsmodell-Facetten könnten und sollten von traditionellen Unternehmen im Zuge ihrer Digitalisierung adaptiert werden.
Wenn das Geschäftsmodell von Plattformen, die, wenn sie funktionieren, ja tatsächlich eine tolle „Gelddruckmaschine“ darstellen, in dieser Szene mehr oder weniger blind über den digitalen Klee gelobt wird, wird dabei zu gerne übersehen, dass es auch heute eben keineswegs so ist, dass jedes beliebige Unternehmen das Geschäftsmodell einer digitalen Plattform für sich nutzen kann oder nutzen sollte.
Fetischisierung des Geschäftsmodells Plattform ist für Investoren ein fragwürdiges Rezept
Gerade für Investoren ist diese Einstellung falsch und gefährlich. Und dies aus drei Gründen:.
Erstens: Die häufig anzutreffende Behauptung, sogenannte Pipeline-Unternehmen würden gegenüber Plattform-Unternehmen zunehmend verlieren, ist so unsinnig wie die Behauptung unsinnig wäre, ein Einkaufszentrum hätte gegenüber einem Schraubenanbieter oder ein Rechtsanwalt oder Steuerberater gegenüber einem Modefilialisten die schlechteren Karten. Der Vergleich macht keinen Sinn.
Im Umfeld der Wirtschaftsprüfer Deloitte wurde vor einigen Jahren eine Studie vorgestellt, die unterschiedliche Unternehmenstypen und ihren durchschnittlichen Multiples innerhalb einer bestimmten Periode verglich. Dieser Studie zufolge schnitten Plattform-Unternehmen ungefähr viermal so gut ab wie konventionelle Pipeline-Unternehmen. Doch was sagt uns das? Es wurden nur erfolgreiche Plattformunternehmen mit erfolgreichen konventionellen verglichen. Es existieren aber wesentlich weniger Infrastruktur-Unternehmen wie Pipeline-Unternehmen, die an Infrastrukturen andocken. Die Grundgesamtheit an analysierbaren Plattformunternehmen ist im Vergleich zu der von Pipeline-Unternehmen viel zu klein. Der Vergleich hinkt schon allein deshalb, weil konventionelle Pipeline-Unternehmen mehr Wettbewerb haben als Plattformen, die in ihren jeweiligen Märkten oft monopolistische Solitäre sind: Apple, Google, Facebook, amazon… . Der überlegene Unternehmenswert muss nicht am Geschäftsmodell liegen, sondern kann in der Marktstellung seinen Grund finden.
Zweitens verleitet die Fetischisierung des Geschäftsmodells „digitale Plattform“ viele Investoren zu dem voreiligen Schluss, erfolgreiche Plattformen böten Facetten, die auch konventionellen ‚Pipeline‘ – Unternehmen gut zu Gesicht stehen. Es gelte, bestehende „Geschäftsmodelle auf den Kopf zu stellen“.
Diese Einstellung findet man sehr häufig bei Beratungsunternehmen, insbesondere bei solchen, die sich den Mittelstand als Zielgruppe auserkoren haben, welcher der luftigen, tendenziell eher produktfernen Geschäftsmodell-Denke von Investoren und Beratern habituell distanziert gegenüber steht.
Diese Einstellung ist schon logisch sehr schlecht begründet. Wenn man von einem Geschäftsmodell einen Teil oder Teile entnimmt und es bzw. sie einem anderen Geschäftsmodell anhaftet, weil dieser Teil bzw. diese Teile dort so prima funktionieren, dann hat man nicht Teile dieses Geschäftsmodells übernommen. Denn in dem Moment, wo man dem Geschäftsmodell eine Facette ‚abklaubt‘, hört das Geschäftsmodell auf Geschäftsmodell zu sein. Es funktioniert (oder funktioniert nicht) nur als Ganzes. Überträgt man also vermeintliche Teile eines Geschäftsmodells auf ein anderes, dann hat man in Wahrheit nur ein zufällig dort vorgefundenes Unternehmensmerkmal übertragen, das mit dem Geschäftsmodell selbst gar nichts zu tun hat und das nur zusammen mit den übrigen, nicht übertragenen Aspekten des Geschäftsmodells, funktionieren kann.
Drittens schließlich wird bei dieser pauschalen Liebe zur Plattform der Aspekt übersehen, den wir oben anhand der gescheiterten Plattfom BranchOut diskutiert hatten: Digitale Plattformen können super funktionieren. Aber sie müssen es nicht. Solche Plattformen sind, gerade weil ihr Erfolg maßgeblich von der großen Zahl der an sie andockenden Nutzer geprägt ist, die eine Plattform nur sehr bedingt steuern und auf Linie halten kann und die, wenn ihnen etwas an der Plattform nicht gefällt, in Windeseile viral zum Shitstorm auf oder auch gleich zum Rückzug von der Plattform blasen können, extrem fragile Geschöpfe.
Digitale Plattformen: Für Venture Capitalisten eine attraktive Option, für Business Angels nicht
Insbesondere aus diesem zuletzt genannten Grund sind digitale Plattformen in meinen Augen keine gute Option für Business Angels. Business Angels sind aufgrund des überschaubaren ihnen möglichen Investitionsvolumens nicht in der Lage, viele Investitionen achselzuckend scheitern sehen zu können, um mit dem einen hoffentlichen Einhorn die so entstandenen Verluste überzukompensieren. Das Risiko, die falsche Plattform als Investitionsziel auserkoren zu haben, ist bei Plattformen, gerade aufgrund ihrer Userabhängigkeit, viel zu hoch. Business Angels sollten in die Anbieter von Werkzeugen investieren, mit denen digitale Plattformen ihre Marktstellung ausbauen und steuern und ihre Risiken minimieren können. Gute Werkzeuge, Datenanalysetools zumal, werden von allen Plattformen, egal ob sie dereinst scheitern oder nicht, benötigt.